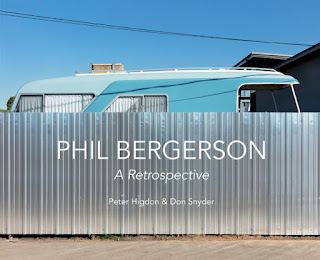"Langsam wird mir klar: Du bist glücklich, weil du gehst." Und: "Je älter ich werde, desto mehr freue ich mich über das Leben. Ich habe immer grössere Angst vor dem Tod. Das erstaunt mich. Ich werde mit dem Alter nicht klüger, im Gegenteil ...". Gleich zu Beginn dieses Buches stolpere ich über diese Sätze. Nicht, dass ich mich mit ihnen identifizieren würde/könnte, doch sie zeigen mir, wie unterschiedlich man die Welt wahrnehmen kann und dass meine eigene Sicht nichts mehr als eine Sicht ist - ein in diesem Moment eigenartig beruhigendes, ja, ein befreiendes Gefühl.
Doch weshalb verlässt ein Mann, der von sich sagt, dass er sich am Leben freut, seine Frau, sein Kind und sein Haus? Er mache sich auf den Weg zu sich selbst, lese ich auf dem Buchumschlag, und frage mich, ob das eine gute Idee ist. Was, wenn ihm dieses Selbst, sollte er es denn finden, nicht gefällt? Wie auch immer, er geht mit Rousseaus 'Bekenntnissen' los, der unter anderem schrieb: "Das Gehen hat etwas, was meine Gedanken erregt und belebt; wenn ich mich nicht bewege, kann ich kaum denken, mein Körper muss gewissermassen in Schwung geraten, um auch meinen Geist zum Schwingen zu bringen."
Einen ersten Anlauf macht er in Wales, einen zweiten in Süddeutschland, beide bricht er nach Kurzem ab, doch aufgeben will er nicht. "Jetzt aber weiss ich, dass es nicht im Handumdrehen getan ist, so zu leben, dass es nicht einfach ist, ein Wandersmann zu werden. Es erfordert Training und Mut, Gewöhnung und Zeit." Fortan übt er das Gehen in Norwegen, im zweiten Teil des Buches dann in Frankreich und Griechenland.
Gehen oder Die Kunst, ein wildes und poetisches Leben zu führen handelt, wie der Titel suggeriert, nicht allein vom Unterwegssein dieses Wanderers (er ist definitiv kein Spaziergänger), sondern auch von den Leuten, die er trifft. Mit einem Mit-Wanderer unterhält er sich über Shakespeare, zu dem dieser eine dezidierte Meinung hat: "Das Theater ist reine Unterhaltung und nichts als ein Zeitvertreib. Das ist es doch, worüber uns die meisten Stücke Shakespeares etwas erzählen; dass unser Leben zu kurz und flüchtig ist, um es mit Missverständnissen und Schauspielen zu vergeuden."
Kein Schreiben, das nicht in erster Linie Autobiografie wäre. "Ich habe immer anders leben wollen. auf gänzlich andere Art als von meiner Erziehung vorgesehen. Von Kindesbeinen an ein tiefsitzender Widerwillen dagegen, das zu tun, was mir gesagt wurde. Ich habe stets alles schwieriger für mich machen wollen. Nie leichter, nie einfacher, immer nur schwieriger, und immer wider unmöglich für mich selbst. Und wohin hat mich das gebracht?. Es hat mich an keine normalen Orte gebracht; ich habe nie eine Arbeit gehabt, es ist mir nie gelungen, mir ein Heim, eine Familie aufzubauen, ein festes Gehalt zu bekommen."
Da Tomas Espedal anders lebt als die meisten, denkt er auch anders als die meisten. Und davon berichtet dieses Buch, das natürlich auch von anderen, die schreiben handelt, und uns von Walt Whitman erzählt, der sein eigenes Buch 'Leaves of Grass' in drei verschiedenen Publikationen positiv besprochen hatte und in der Folge von Henry David Thoreau aufgesucht wurde, der zu seiner Überraschung einen ausgesprochen häuslichen Büromenschen antraf, der, so Espedal, "in meiner Vorstellung das gesündeste und kraftvollste aller Wandergedichte schreibt, den 'Song of the Open Road'" (der sich auch in diesem Buch findet).
Und auch vom Dichter Olav Nygard erzählt er, der ihm zu Bewusstsein bringt, "dass alles, wonach wir uns sehnen, hier ist, ganz gleich, wo wir sind, direkt vor unseren Augen." Eine Lektion, die er, der nach den idealen äusseren Umständen sucht, wie er weiss, besonders nötig hat und ironisch so kommentiert: "Jeden Tag sass ich am Schreibtisch, starrte in den Raum hinein und freute mich über seine Schönheit, die ich mühevoll aufgebaut hatte; es war ein perfektes Zimmer. Ein perfektes Arbeitszimmer. Ich schrieb nichts in diesem Zimmer."
Leben als Selbsterforschung, zu der auch die Auseinandersetzung mit der Natur und den Ideen von anderen gehört, gelingt eindrücklicher, wenn man in die Welt rausgeht, denn es ist die körperliche Erfahrung, die einen lehrt, Teil der Welt zu sein.
Fazit: Spannend, überzeugend und anregend.
Thomas Espedal
Gehen oder Die Kunst, ein wildes
und poetisches Leben zu führen
Matthes & Seitz, Berlin 2020